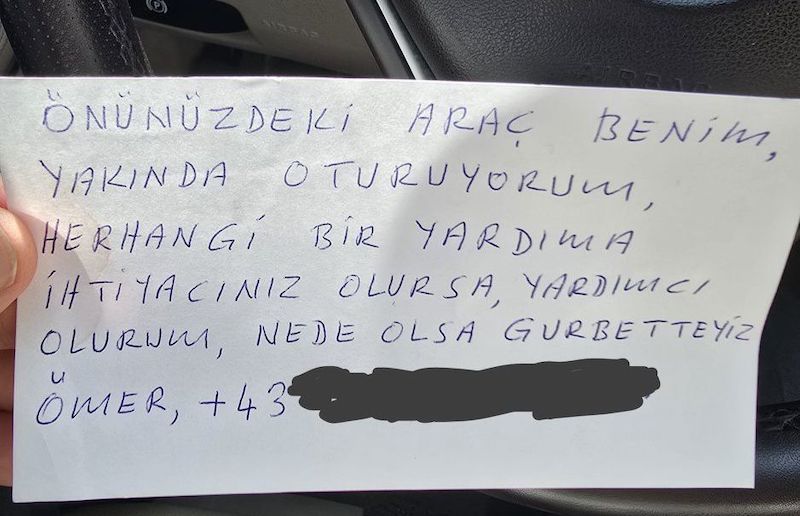Aus dem Gefängnis den Justizminister anrufen?
Der Film „Green Book“ thematisiert ein Gefühl, das selten und irgendwie unbezahlbar ist.

Köksal Baltaci
Es gibt da diese Szene in dem Oscar-Favoriten „Green Book“ (derzeit im Kino), der in den USA der 1960er-Jahre spielt und eine wahre Geschichte erzählt.
Ein farbiger Musiker und sein weißer Fahrer werden von der Polizei angehalten und provoziert, woraufhin der Fahrer einem der Polizisten ins Gesicht schlägt.
Er wird verhaftet – und der Musiker auch, dabei hat er gar nichts getan. Davon versucht er die Polizisten auch zu überzeugen, wird aber nicht ernst genommen.
Bis er von seinem Recht Gebrauch macht, einen Anruf zu tätigen.
Minuten später kommen beide frei. Zurück im Auto erfährt der Fahrer, dass der Musiker Justizminister Robert F. Kennedy anrief, der ihre Freilassung veranlasste, indem er damit drohte, die Nationalgarde zu schicken.
Der Fahrer jubelt vor Freude, kann sein Glück kaum fassen. Der Musiker hingegen ist am Boden zerstört.
Er hasst sich selbst dafür, diesen „Joker“ gezogen zu haben, macht sich Sorgen um sein Ansehen bei Kennedy.
Diese Szene verdeutlicht vor allem eines: Der Fahrer hat in seinem Leben keinerlei Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht.
Selbst wenn, wirklich gelitten hat er darunter offensichtlich nicht und kann daher die Demütigung nicht verstehen, die einer solchen Situation innewohnt.
Er sieht nur den Einfluss eines reichen Mannes, zu dessen Freunden der Justizminister gehört.
Der Musiker hingegen ist mit diesen Kränkungen aufgewachsen.
Weiß, wie es ist, von einem Polizisten beleidigt, von dessen oberstem Chef aber hofiert zu werden.
Wer diese Erfahrungen gemacht hat, wünscht sie keinem anderen – im wörtlichen Sinn.
Denn wenn man ihren Wert erst einmal erkannt hat, trägt man sie mit sich wie einen Schatz und will sie mit niemandem teilen. Sie stützen und nähren einen.
Sie richten auf und holen einen zurück auf den Boden, wenn man abhebt.
So vergisst man nie, wer man ist. Und: wer man nicht ist. Die Presse